Inhaltsverzeichnis
Das kohärente Europäische Schutzgebietsnetz Natura 2000
Verträglichkeitsprüfung in der ländlichen Bodenordnung
 | Verfahrensschritte zur Prüfung nach § 34 BNatSchG | Gebietskulisse |
 |  | Prüfschritt 1: Vorprüfung |
 |  | Prüfschritt 2: Verträglichkeitsprüfung |
 |  | Prüfschritt 3: Alternativenprüfung |
 |  | Prüfschritt 4: Ausnahmeprüfung |
 | Ablaufschema zur Prüfung nach § 34 BNatSchG |  |
|  |  |
 | Erläuterungen | Erhaltungsziele |
 |  | Maßgebliche Bestandteile |
 |  | Prioritäre Lebensraumtypen und Arten |
 |  | Erhebliche Beeinträchtigungen |
 |  | Kohärenzausgleich |
 |  | Verschlechterungsverbot |
 |  | Umgebungsschutz |
|  |  |
 | Verhältnis der Verträglichkeitsprüfung zur Umweltverträglichkeitsprüfung und zur Eingriffsregelung |  |
|  |  |
 | Gliederung einer Verträglichkeitsuntersuchung |  |
|  |  |
 | Literaturhinweise |  |
Das kohärente Europäische Schutzgebietsnetz Natura 2000
Die Europäische Vogelschutzrichtlinie und die Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie verpflichten die Mitgliedstaaten, ein zusammenhängendes Europäisches ökologisches Netz besonderer Schutzgebiete mit der Bezeichnung Natura 2000 zu errichten, denn durch den Schutz einzelner und isolierter Lebensräume kann der anhaltende Artenrückgang auf Dauer nicht aufgehalten werden. Hauptziel von Natura 2000 ist es, die in der EU vorhandene biologische Vielfalt zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Auf der Grundlage der FFH-Richtlinie ist ein günstiger Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume und der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse zu bewahren bzw. wieder herzustellen. Die Er-haltung der biologischen Vielfalt kann in bestimmten Fällen die Beibehaltung oder auch die Förderung bestimmter Tätigkeiten des Menschen erfordern, wie z.B. eine extensive Bewirtschaftung bestimmter Flächen.
Die Verträglichkeitsprüfung in der Ländlichen Bodenordnung
Für die in den Natura 2000-Gebieten zu schützenden natürlichen Lebensräume und Arten gilt gemäß Art. 6 Abs. 2 FFH-Richtlinie ein Verschlechterungsverbot. Um dies zu gewährleisten, hat die EU neben einem modernen Naturschutzmanagement auch die sogenannte Verträglichkeitsprüfung eingeführt. Die für die Verträglichkeitsprüfung relevanten Schutzvorschriften der FFH-Richtlinie sind durch die §§ 32 bis 38 sowie
§ 10 Abs.1 Nr.11 des neu gefassten Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 25. März 2002 (BGBl. 2002 I s. 1193 ff) in nationales Recht umgesetzt worden. Sie sind auch für die Verfahren der Ländlichen Bodenordnung verbindlich.
Danach sind in Bodenordnungsverfahren nach dem FlurbG die Maßnahmen im Plan nach § 41 FlurbG sowie die Maßnahmen in Verfahren ohne Plan nach § 41 FlurbG vor ihrer Zulassung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen oder dem Schutzzweck eines betroffenen Natura 2000-Gebietes zu überprüfen. Sinngemäß ist dies auch für Maßnahmen, die in einem freiwilligen Nutzungstauschverfahren durchgeführt werden, anzuwenden.
Verfahrensschritte zur PRÜFUNG nach § 34 BNatSchG
Gebietskulisse
In Bodenordnungsverfahren sind folgende Gebiete in die Prüfung auf Betroffenheit und gfls. Verträglichkeit einzubeziehen:
- die durch das Land gemeldeten FFH-Vorschlagsgebiete;
- eventuelle FFH-Konzertierungsgebiete (Art. 5 FFH-RL);
- die durch das Land gemeldeten Vogelschutzgebiete .
Die Karten mit den Gebietsabgrenzungen können im Internet unter (www.naturschutz.rlp.de) abgerufen werden.
Prüfschritt 1:
Vorprüfung
(Entspricht der Prüfphase 1 der “Methodik-Leitlinien zur Erfüllung der Vorgaben das Artikels 6 Absätze 3 und 4 der Habitatrichtlinie 92/43 EWG” der Europäischen Kommission, GD Umwelt, 2001)
Liegt ein Natura 2000-Gebiet ganz oder teilweise im Verfahrensgebiet oder in dessen möglichem Einwirkungsbereich, so ist als erstes über eine Prognose im Sinne einer Grobabschätzung zu klären, ob von den Maßnahmen des Bodenordnungsverfahrens erhebliche Beeinträchtigungen auf das geschützte oder zu schützende Gebiet ausgehen können.
Hierbei ist wie folgt vorzugehen:
- Darstellung des Natura 2000-Gebietes und seinen für den Schutz maßgeblichen Bestandteilen (siehe Erläuterungen) aus vorhandenen Daten sowie überschlägige Formulierung der Erhaltungsziele.
- Kurze Beschreibung des Bodenordnungsverfahrens und anderer Projekte und Pläne, bei denen die Möglichkeit besteht, dass sie im Zusammenwirken erhebliche Auswirkungen auf das Natura 2000-Gebiet hervorrufen können.
- Ermittlung der möglichen Auswirkungen auf das Natura 2000-Gebiet
- Entscheidung über die Erheblichkeit etwaiger Auswirkungen.
Wenn mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen ist bzw. diese nach einer überschlägigen Prüfung nicht eindeutig ausgeschlossen werden können, ist eine Verträglichkeitsprüfung durchzuführen.
Im Rahmen der Vorprüfung ist bereits frühzeitig die zuständige Landespflegebehörde zwecks Abstimmung zu beteiligen (vgl. Ziff. 3.1.3 des Rundschreibens über die Zusammenarbeit der Flurbereinigungsbehörden mit den Landespflegebehörden sowie Ziff. 2.9.1 und Ziff. 2.9.2 i.V.m. Ziff. 2.8.1 der Planfeststellungsrichtlinie vom 22.01.2003). Wenn zweckmäßig, kann auch eine Ortsbesichtigung erfolgen; ggf. können weitere Fachleute hinzugezogen werden.
Diese Vorprüfung sollte, falls eine projektbezogene AEP durchgeführt wird, in dieser abgehandelt werden; falls sich nach Einleitung der Bodenordnung Veränderungen oder neue Erkenntnisse ergeben, ist die Vorprüfung zu ergänzen oder zu erneuern. Falls keine projektbezogene AEP durchgeführt wird, ist die Vorprüfung zu einem geeigneten Zeitpunkt durchzuführen.
Falls keine projektbezogene AEP durchgeführt wird, ist die Vorprüfung vor oder unmittelbar nach Einleitung der Bodenordnung durchzuführen.
Falls keine projektbezogene AEP durchgeführt wird, sollte die Vorprüfung spätestens mit dem Scoping-Termin durchgeführt werden.
Prüfschritt 2:
Verträglichkeitsprüfung
Für die Verträglichkeitsprüfung nach § 34 Abs. 1 BNatSchG legt die Flurbereinigungsbehörde die notwendigen fachgutachterlichen Angaben der Zulassungsbehörde vor. Diese werden in der sogenannten Verträglichkeitsuntersuchung im Zusammenhang dargelegt. Strukturierung und inhaltliche Ausgestaltung dieser Verträglichkeitsuntersuchung richten sich nach den “Leistungsinhalten zur Durchführung von Verträglichkeitsuntersuchungen nach §§ 34 und 35 BNatSchG bei Betroffenheit von FFH- und/oder Vogelschutzgebieten (Natura 2000-Gebieten) durch Bodenordnungsverfahren” .
Grundsätzlich ist ein Projekt unzulässig, wenn ein Natura 2000-Gebiet in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen erheblich beeinträchtigt wird (§ 34 Abs. 2 BNatSchG).
Nur in ganz besonderen Fällen ist eine Ausnahme vom Verträglichkeitsgrundsatz möglich (§ 34 Abs. 3 bis 5 BNatSchG).
Prüfschritt 3:
Alternativenprüfung:
Sind in Bodenordnungsverfahren Maßnahmen geplant, die einzeln oder zusammen mit anderen Projekten oder Plänen zu erheblichen Beeinträchtigungen der Natura 2000-Gebiete führen können, sind Alternativen zu wählen, die ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele für das Gebiet verbunden sind. In Betracht kommen z. B. eine geänderte Standort-/Trassenwahl, eine andere Art der Ausführung bzw. Vorgaben zur Ausführung (z. B. Reduzierung des Versiegelungsgrades, zeitliche Vorgaben für die Projektabwicklung, eine den Schutzerfordernissen entsprechende Wegenetzplanung und/oder Neuzuteilung).
Ist eine zumutbare (z.B. Erhöhte finanzielle Aufwendungen sind i. d. Regel zumutbar; Kosten außerhalb jedes vernünftigen Verhältnisses sind jedoch unzumutbar.) Alternative möglich, so ist diese zwingend zur Realisierung zu wählen (strikt beachtliches Vermeidungsgebot). Bestehen keine zumutbaren Alternativen, ist zu prüfen, ob Ausnahmen gemäß § 34 Abs. 3 bis 5 BNatSchG möglich sind.
Prüfschritt 4:
Ausnahmeprüfung:
Sollen die in der Bodenordnung vorgesehenen Maßnahmen trotz des negativen Ergebnisses der Verträglichkeitsprüfung realisiert werden, so ist das nur aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses und bei fehlenden Alternativen möglich. Gleichzeitig kann das Projekt nur zugelassen werden unter Festlegung aller notwendigen Ausgleichsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Zusammenhanges des Netzes Natura 2000. Die Maßnahmen müssen also bewirken, dass das Netz Natura 2000 keinen Schaden nimmt. Die Kohärenz des Schutzgebietsnetzes ist nur gewahrt, wenn die Maßnahmen zum Zeitpunkt der Beeinträchtigung des Gebietes bereits wirksam sind (Louis, 1998: Kommentierung zu § 19c Rd.Nr. 33).
Bei der Prüfung von Ausnahmen, im Falle einer erheblichen Beeinträchtigung, ist wie folgt zu verfahren:
- Das Fehlen von zumutbaren Alternativen muss nachvollziehbar begründet werden.
- Die zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses müssen dargelegt werden
(Zur Ausnahmebegründung müssen die Interessen deutlich gewichtiger sein als die durch die FFH- und Vogelschutzrichtlinie geschützten Interessen. Bei der Abwägung ist zu berücksichtigen, dass schon die Tatsache, dass ein europäisches Schutzgebiet vorliegt, den Belangen von Natur und Landschaft ein erhebliches Gewicht verleiht. Je größer die Bedeutung des Gebietes für die Kohärenz des ökologischen Netzes Natura 2000 ist, um so weniger können die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege durch öffentliche Interessen überwunden werden (Louis, 1998, Rd.Nr. 19 zu § 19c BNatSchG)..
- Die erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung des Zusammenhangs des Euro-päischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 müssen nachgewiesen werden (vgl. § 34 Abs. 5 BNatSchG).
- Im Falle einer Beeinträchtigung prioritärer Lebensräume oder Arten darf das Vorhaben nur genehmigt werden, wenn es im überwiegend öffentlichen Inte-resse durchgeführt werden soll (§ 34 Abs. 4 BNatSchG)
- zum Gesundheitsschutz des Menschen,
- aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder
- wegen seiner günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder
- aus anderen zwingenden Gründen des überwiegend öffentlichen Interesses, wobei dann vor einer Zulassung zusätzlich über das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit eine Stellungnahme der EU-Kommission einzuholen ist.
Die EU-Kommission ist bei Zulassung von Ausnahmen über die veranlassten Sicherungsmaßnahmen zu Gunsten von Natura 2000 zu unterrichten. |
Ablaufschema zur Prüfung nach § 34 BNatSchG
in der Ländlichen Bodenordnung
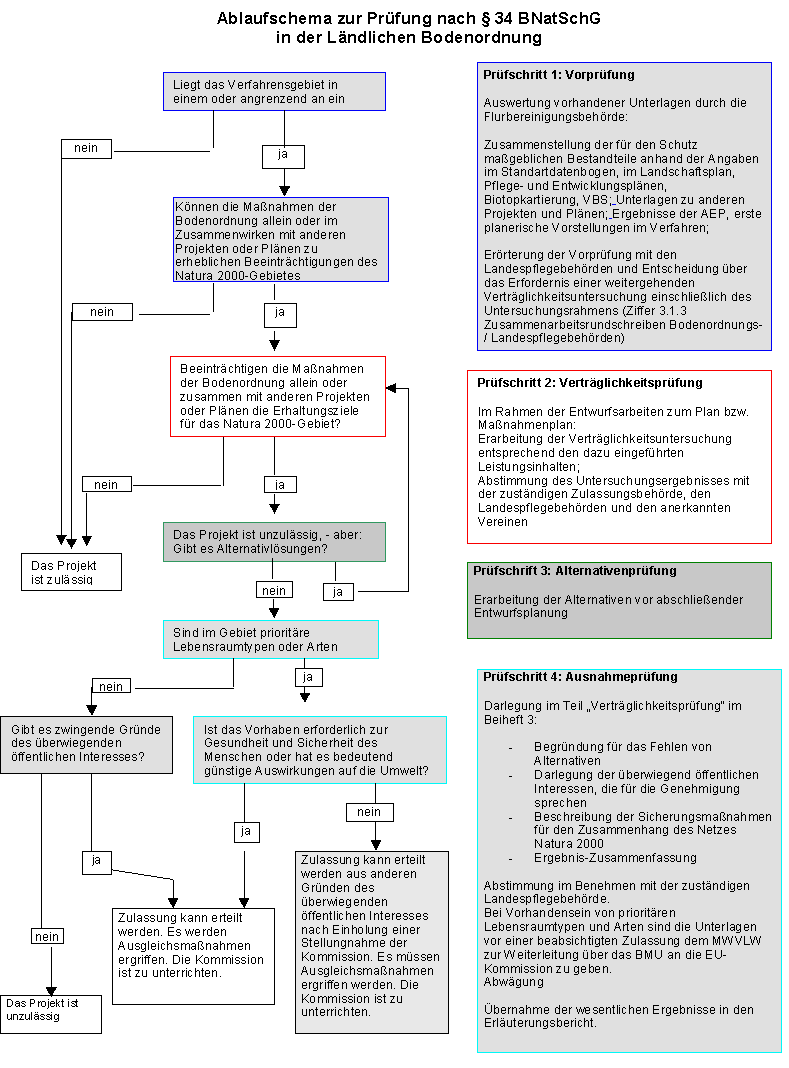
Erhaltungsziele
Die FFH-Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, die Erhaltungsziele für die beson-deren Schutzgebiete festzulegen. Diese müssen darauf gerichtet sein, die in den Natura 2000-Gebieten vorkommenden natürlichen Lebensraumtypen (Anh. I FFH-RL) und Populationen wildlebender Tier- und Pflanzenarten (Anh. II FFH-RL sowie Anh. I und Art. 4 Abs. 2 VS-RL) in einem günstigen Erhaltungszustand zu erhalten oder einen solchen wieder herzustellen.
Die Erhaltungsziele sind der entscheidende fachliche Bewertungsmaßstab für die Verträglichkeitsprüfung. Ihre Festlegung ist grundsätzlich Aufgabe der zuständigen Landespflegebehörden im Rahmen der Schutzausweisungen. Da diese Schutzaus-weisungen erst nach Vorliegen der Gemeinschaftsliste (Art. 4 Abs. 2 FFH-RL) erfol-gen, wird bis zur Formulierung der Erhaltungsziele noch einige Zeit vergehen. Der Gutachter einer Verträglichkeitsuntersuchung muss sie deshalb notgedrungen selbst erarbeiten. Das geschieht zweckmäßig im Dialog und möglichst im Einvernehmen mit den zuständigen Landespflegebehörden. Im Fall der externen Vergabe sollten sich die beteiligten Behörden möglichst im Termin nach Ziffer 3.1.3 des Zusammenar-beitserlasses auf einen Gutachter einigen.
Die Erhaltungsziele beinhalten die Summe der Maßnahmen und Anforderungen zur Sicherung oder zur Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der für das Gebiet wertbestimmenden bzw. signifikanten Lebensräume und Arten von ge-meinschaftlicher Bedeutung.
Zunächst sind der günstige Erhaltungszustand zu bestimmen (z.B. anhand von Um-weltqualitätszielen und –standards oder von Zielvorgaben für Populationen u.ä.) und notwendige Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen zu formulieren. Wertvolle Sachinformationen dazu liefern in erster Linie die Natura 2000-Datenbögen. Weiter kann auf vorhandene Informationen wie z.B. Schutzgebietsverordnungen, Land-schaftspläne, andere Fach- und Sachinformationen der Landespflegebehörden zu-rückgegriffen werden, soweit diese den besonderen Zielen und Anforderungen der FFH- und Vogelschutzrichtlinie entsprechen.
Maßgebliche Bestandteile (§ 34 Abs.2 BNatSchG)
Maßgebliche Bestandteile für die Erhaltungsziele eines Natura 2000-Gebietes sind jene Teile, die den Anlass für den Gebietsvorschlag bzw. die Unterschutzstellung darstellen. Sie sind für die Verträglichkeitsprüfung entscheidungserheblich und müssen deshalb entsprechend genau erfasst werden.
Es zählen hierzu regelmäßig:
In FFH-Gebieten:
- vorkommende Lebensraumtypen sowie Tier- und Pflanzenarten der Anhänge I und II der FFH-RL, v.a. prioritäre Lebensraumtypen und Arten,
- die für die zu erhaltenden oder wiederherzustellenden Lebensraumtypen maßgeblichen standörtlichen Voraussetzungen (z.B. bestimmte Ausprägungen der abiotischen Standortfaktoren) und die funktionalen Beziehungen zwischen (Teil-)Lebensräumen innerhalb und evtl. auch zu (Teil-)Lebensräumen außerhalb des Gebietes.
In Europäischen Vogelschutzgebieten:
- vorkommende Vogelarten des Anhangs I und des Art. 4 Abs. 2 Vogelschutz-RL
- deren zu erhaltende oder wiederherzustellende Lebensräume und maßgebliche standörtliche Voraussetzungen (z.B. abiotische Standortfaktoren) und die funktionalen Beziehungen zwischen und zu (Teil-)Lebensräumen innerhalb und außerhalb des Gebietes.
Prioritäre Lebensraumtypen und Arten
Das sind die Lebensraumtypen und Arten, die im Gebiet der Europäischen Gemeinschaften vom Aussterben bedroht sind und für deren Erhaltung der Gemeinschaft eine besondere Verantwortung zukommt. Sie sind in den Anhängen I und II der FFH-RL mit einem Sternchen gekennzeichnet.
Erhebliche Beeinträchtigungen
Beeinträchtigungen ergeben sich aus den von einem Bodenordnungsverfahren ausgehenden direkten und indirekten Wirkungen auf die für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck des jeweiligen Natura 2000-Gebietes maßgeblichen Bestandteile. Die prognostizierten Beeinträchtigungen sind daraufhin zu überprüfen, ob sie erheblich sind.
Wann eine Beeinträchtigung z.B. direkt durch Neu- oder Umbaumaßnahmen oder indirekt in Folge dieser Maßnahmen, z.B. durch die neue Grundstücksgestaltung und –zuteilung, erheblich ist, kann immer nur im konkreten Einzelfall bewertet werden. Die Maßstäbe für die Bestimmung der Erheblichkeit der Beeinträchtigungen müssen sich aus der Definition des günstigen Erhaltungszustandes (Art. 1e und i FFH-RL) im Rahmen der Erhaltungsziele und aus dem Verschlechterungsverbot (Art. 6 Abs. 2 FFH-RL) ableiten.
Zur Bestimmung der Erheblichkeit von Wirkungen können Schlüsselindikatoren dienen wie z. B. Dauer und Permanenz von Störungen sowie der Abstand vom Gebiet, die relative Veränderung bei wichtigen chemischen Kennwerten z.B. der Wasserqualität und auch der prozentuale Flächenverlust von Lebensräumen.
Allgemein ist zu beachten:
- Je schutzwürdiger und empfindlicher ein Lebensraum oder eine Art ist, desto eher ist von einer erheblichen Beeinträchtigung auszugehen.
- Beeinträchtigungen sind erheblich, wenn ein Natura 2000-Gebiet in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen derart verändert wird, dass deren Funktionen und damit auch die Funktionen des Gebietes als Ganzes nur noch deutlich eingeschränkt erfüllt werden. Die Beeinträchtigungen müssen sich auf die zu schützenden Lebensräume und Arten mehr als unerheblich und nicht nur vorübergehend auswirken.
- Das Eintreten erheblicher Beeinträchtigungen muss hinreichend wahrscheinlich sein. Eine absolute Sicherheit kann vielfach jedoch nicht oder nur mit erheblichem Untersuchungsaufwand erreicht werden. Bei Unsicherheiten ist im Sinne der Vorsorge zugunsten der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu beurteilen.
- Jede einzelne erhebliche Beeinträchtigung eines für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteiles führt zur Unverträglichkeit des Projekts. Ein Ermessensspielraum besteht innerhalb § 34 Abs. 2 BNatSchG nicht.
- Beeinträchtigungen prioritärer Lebensräume und Arten sind regelmäßig erheblich.
- Erhebliche Beeinträchtigungen können auch aus Vorhaben außerhalb des Gebietes erwachsen z.B. durch Stoffeinträge über den Luft- oder Wasserpfad, durch Lärmeinwirkungen, Erschütterungen, Zerstörung wesentlicher, für die Erhaltungsziele substanziell bedeutsamer Standortfaktoren (z.B. Grundwasserabsenkung, Änderung der landwirtschaftliches Nutzungsart, Erhöhung der Nutzungsintensität durch Düngung).
- Auch an sich geringfügige Beeinträchtigungen können in der Summe zu einer erheblichen Beeinträchtigung führen. Daher sind auch kumulative Wirkungen, die erst im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen erheblich sein können, in die Prüfung einzubeziehen.
- Die Feststellung, dass voraussichtlich keine Beeinträchtigung zu erwarten ist, ist von den jeweiligen Erhaltungszielen im Einzelfall abhängig.
Kohärenzausgleich
Wenn ein Projekt, welches zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura 2000-Gebietes führt, dennoch zugelassen werden soll, müssen Maßnahmen zur Sicherung des Zusammenhangs des Europäischen ökologischen Netzes Natura 2000 durch-geführt werden. Diese müssen gewährleisten, dass das Netz seine Funktionen ohne Einschränkung erfüllen kann. Die Sicherungsmaßnahmen sind Voraussetzung für die Zulassung und müssen bereits wirksam sein, wenn das zuzulassende Projekt begonnen wird. Sie unterscheiden sich in ihrer Zielsetzung von den Ausgleichsmaßnahmen der Eingriffsregelung und dürfen damit nicht verwechselt werden.
Im Einzelfall kommen in Betracht:
- Verbesserungsmaßnahmen innerhalb des betroffenen Gebietes,
- Erweiterung eines Gebietes um Flächen am Rande oder in seinem räumlichen Zusammenhang mit Durchführung entsprechender Maßnahmen,
- Aufwertungsmaßnahmen innerhalb anderer Natura 2000-Gebiete,
- In schwerwiegenden Fällen komplette Neuausweisung eines Gebietes mit Durchführung der erforderlichen Maßnahmen.
Nach den Vorstellungen der EU-Kommission sollen die Sicherungsmaßnahmen
- auf die beeinträchtigten Lebensräume und Arten ausgerichtet sein,
- sich auf die gleiche biogeografische Region im selben Mitgliedstaat beziehen und möglichst nahe zu dem durch das Projekt beeinträchtigten Lebensraum liegen,
- einen funktionalen Ausgleich gewährleisten und
- klar definierte Maßnahmen und Managementziele aufweisen.
Verschlechterungsverbot
Nach Art. 6 Abs. 2 FFH-RL sind die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, Verschlechterungen der Natura 2000-Gebiete zu verhindern. Dies bedeutet, dass diejenigen Lebensraumtypen und Arten, für die das Gebiet ausgewiesen wird, nicht erheblich beeinträchtigt werden dürfen. Erfolgt z.B. eine Schutzgebietsausweisung zum Erhalt und zur Entwicklung einer Amphibienpopulation, dann bezieht sich das Störungs- und Verschlechterungsverbot auf diese Tiere und ihre Habitate, nicht gleichzeitig auf die ebenfalls im Gebiet vorkommenden Vogelarten.
Aktuelle Nutzungen durch die Land- und Forstwirtschaft oder den Tourismus bleiben wie bisher möglich, sofern sie die Erhaltungsziele nicht beeinträchtigen.
Umgebungsschutz
Durch diese neue rechtliche Verpflichtung zum Schutz der Natura 2000-Gebiete müssen künftig nicht nur Projekte und Pläne innerhalb eines solchen Schutzgebietes auf ihre Verträglichkeit mit dessen Erhaltungszielen geprüft werden, sondern auch Projekte und Pläne, die von außen erheblich auf das Gebiet einwirken können. Beispielsweise kann sich auch ein im Umfeld eines Natura 2000-Gebietes angelegter landwirtschaftlicher Weg nachteilig auf das Vorkommen von störungsempfindlichen Brutvögeln im geschützten Gebiet auswirken. Die Anlage eines Wegeseitengrabens außerhalb des Schutzgebietes kann erhebliche Beeinträchtigungen eines geschützten Niedermoorstandortes innerhalb des Gebietes verursachen.
Verhältnis der Verträglichkeitsprüfung zur Umweltverträglichkeitsprüfung und zur Eingriffsregelung
Mit der Verträglichkeitsprüfung wurde ein neues naturschutzrechtliches Instrumentarium geschaffen, das sich von der Umweltverträglichkeitsprüfung und der Eingriffsregelung deutlich unterscheidet. Dies zeigt eine vergleichende Betrachtung z.B. der Anwendungsbestimmungen, der Schutzgüter, der Ermittlungs- und Bewertungsaufgaben sowie vor allem der Rechtsfolgen (vgl. Abb. 1). Es ist deshalb erforderlich, die Verträglichkeitsprüfung im Beiheft 3 in einem gesonderten Kapitel im Zusammenhang abzuhandeln. In den Erläuterungsbericht sind, unter Verweis auf die Gesamtunterlagen, die entscheidungserheblichen Kernaussagen zu übernehmen, da der Erläuterungsbericht zumindest in den Verfahren mit Plan nach § 41 FlurbG Bestandteil der Zulassung wird und im Bedarfsfall die Abwägungsgrundlagen für ein Ausnahmeverfahren enthalten muss.
In der Bodenordnung kommt es mehrfach vor, dass alle drei Instrumente nebeneinander zum Tragen kommen. Trotz ihrer in Abbildung 1 erkennbaren Unterschiede weisen sie auch Überschneidungen auf, die bei der Verfahrensabwicklung und der Erarbeitung der Planunterlagen berücksichtigt werden sollten, um die Arbeit möglichst effizient zu gestalten.
Die Verträglichkeitsprüfung bezieht sich in der Regel auf einen räumlich und sachlich abgegrenzten Teilausschnitt des Naturhaushalts bzw. der im Rahmen der Eingriffsregelung und der UVP zu bearbeitenden Schutzgüter (insbesondere Arten und Lebensräume, je nach Relevanz aber auch Boden, Wasser und Luft) und muss für ihren Teil inhaltlich-methodisch anderen Anforderungen genügen als die Untersuchungen zur UVP oder für die Eingriffsregelung. Gleichzeitig ist sie, anders als die UVP, an Rechtsfolgen gebunden und kann unmittelbar zur Unzulässigkeit des Projektes führen, sodass sich dann weitere Untersuchungen etwa zur UVP erübrigen. Insoweit ist es zweckmäßig, sie zuerst abzuhandeln.
Für die UVP stellt § 34 BNatSchG einen fachrechtlichen Bewertungsmaßstab dar, ebenso wie die §§ 4 bis 6 LPflG. Die im Rahmen der Verträglichkeitsuntersuchung erarbeiteten Unterlagen können insoweit in die UVP und auch die Abhandlung der Eingriffsregelung einfließen und müssen entsprechend dem jeweiligen Prüfumfang nur ergänzt werden. Im einzelnen ist das Verhältnis der Verträglichkeitsprüfung zur UVP und zur Eingriffsregelung in Abb. 1 vergleichend zusammengefasst. |
 | Verträglichkeitsprüfung | Eingriffsregelung | Umweltverträglich-
keitsprüfung |
| Rechtsgrundlage | FFH-Richtlinie bzw. §§ 34 und 35 BNatSchG |
§ 8 BNatSchG bzw.
§§ 4 – 6 LPflG
|
|
| Ziele | Schutz des kohärenten Netzes Natura 2000 zur Bewahrung der biologischen Vielfalt in der Europäischen Gemeinschaft |
Minimierung und Ausgleich von Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes bei Eingriffsvorhaben zur materiellen Sicherung des Status quo
|
Frühzeitige und umfassende Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen eines Vorhabens
|
Auslöser der
Prüfungspflicht | Alle Pläne und Projekte, die ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung in seinen Erhaltungszielen erheblich beeinträchtigen können (einzeln oder in Summationswirkung mit anderen Plänen/Projekten) |
Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, durch die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt werden können
|
Beschränkung auf bestimmte Vorhaben der Anlage 1 zu § 3 UVPG:
- alle in Spalte 1 gekennzeichneten Vorhaben
- die in Spalte 2 gekennzeichneten Vorhaben nach Vorprüfung
- im Einzelfall (Bodenordnung: Bau der gemeinschaftl. und öffentlichen Anlagen)
- standortbezogen
- nach Landesrecht
|
| Prüfungsbezug | Gebietsbezogene Prüfung |
|
|
| Untersuchungsraum | Natura 2000-Gebiet, einschl. seines Bezuges zum Netz Natura 2000 und Bereichen für notwendige Sicherungsmaßnahmen |
Vorhabens-, wirkungs- und schutzgutbezogene Abgrenzung des Untersuchungsraumes sowie Betrachtung von Räumen für Kompensationsmaßnahmen
|
Vorhabens-, wirkungs- und schutzgutbezogene Abgrenzung des Untersuchungsraumes
(in der Bodenordnung:
in der Regel Verfahrensgebiet)
|
Schutz- und Bewertungs-
gegenstände | Lebensraumtypen (Anh. I FFH-RL)
Arten (Anh. II FFH-RL sowie Anh. I u. Art. 4 Abs. 2 VS-RL) nach Maßgabe der Erhaltungsziele
(Bewertungsmaßstab sind die Erhaltungsziele) |
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes insgesamt und Landschaftsbild
(unter Zugrundelegung von §§ 1 und 2 LPflG)
|
Beurteilung aller Umweltwirkungen auf Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Klima, Luft, Landschaft, Sach- und Kulturgüter
|
| Rechtsfolgen | Unzulässigkeit bei erheblicher Beeinträchtigung der Erhaltungsziele für ein Natura 2000-Gebiet
(aber: Ausnahmeverfahren möglich) |
Unterlassung vermeidbarer Beeinträchtigungen;
Ausgleich unvermeidbarer Beeinträchtigungen;
Abwägung: Untersagung, wenn Vorrang landespflegerischer Belange und Beeinträchtigungen nicht ausgleichbar
|
So früh wie möglich Berücksichtigung der Ergebnisse der UVP bei behördlichen Entscheidungen
(keine eigenständigen Rechtsfolgen)
|
| Alternativenprüfung | Prüfung zumutbarer Alternativen, die den mit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen (für das Natura 2000-Gebiet) erreichen |
Prüfung von Standort- und Durchführungsalternativen im Rahmen des Vermeidungs- und Minimierungsgebotes
|
Übersicht über die wichtigsten anderweitigen vom Vorhabensträger geprüften Alternativen und Angabe der wesent-lichen Auswahlgründe unter besonderer Berücksichtigung der Umweltauswirkungen
|
| Ausgleich | Maßnahmen zur Sicherung des Zusammenhangs von Natura 2000 |
Funktionaler Ausgleich, ggf. Ersatzmaßnahmen bzw. Zahlung einer Ausgleichsabgabe
|
Beschreibung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen analog zur Eingriffsregelung
|
Öffentlicheits-
beteiligung | Nach den Regelungen im BNatSchG gegenwärtig nicht vorgesehen |
Nach Maßgabe anderer Fachgesetze
|
Einbeziehung der Öffentlichkeit
|
Abb. 1: Verhältnis der Verträglichkeitsprüfung zur UVP und zur Eingriffsregelung (verändert nach
RP Darmstadt, 1999), Kursiv: Geltung für die Bodenordnung.
Gliederung einer Verträglichkeitsuntersuchung
(Kurzfassung der “Leistungsinhalte zur Durchführung von Verträglichkeitsuntersuchungen nach § 34 und 35 BNatSchG bei Betroffenheit
von FFH- und/oder Vogelschutzgebieten (Natura 2000-Gebieten) durch Bodenordnungsverfahren” der ADD vom )
| 1 | Beschreibung des Vorhabens und ggfls. anderer Projekte und Pläne |
|  |
| 2 | Bestandsaufnahme und Bewertung |
|  |
| 2.1 | Abgrenzung des Untersuchungsgebietes |
|  |
| 2.2 | Gebietsbeschreibung |
|  |
| 2.2.1 | Maßgebliche Bestandteile |
 |
- Lebensraumtypen (Anh. I FFH-RL)
- Arten (Anh. II FFH-RL)
- Vögel (Anh. I und Art. 4 Abs. 2 VS-RL)
- Standortfaktoren und funktionale Beziehungen
- Gefährdungen / Vorbelastungen
|
|  |
| 2.2.2 | Beschreibung/Ableitung der Erhaltungsziele |
|  |
| 3 | Prognose der erheblichen Beeinträchtigungen (bei Projekten mit ausschließlichen oder überwiegenden Privatinteressen endet die Untersuchung an dieser Stelle: entweder Zulässigkeit weil keine erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten sind oder andernfalls Unzulässigkeit) |
Wenn bei Unverträglichkeit ein Verfahren ausnahmsweise zugelassen werden soll:
| 4 | Prüfung von Alternativen |
|  |
| 5 | Darlegung der Ausnahmegründe |
|  |
| 6 | Entwicklung und Beschreibung von Maßnahmen zur Sicherung des Zusammenhangs des Schutzgebietsnetzes Natura 2000 (Kohärenzausgleich) |
|  |
| 7 | Zusammenfassung der Ergebnisse |
|