Über kaum etwas wurde in den vergangenen Jahren in der Weinbranche so hitzig debattiert, wie über den französischen Begriff des „Terroir“. Für die Einen sind Terroirweine der Gegenentwurf zu Globalisierung und Industrialisierung, für die Anderen ist „Terroir“ eher das Unwort des Jahres. Noch immer sind Weine, die „Herkunft, Boden und Heimat“ verkörpern, ein Arbeitsfeld für Weinbau, Kellerwirtschaft und Vermarktung. Die Frage: „Was ist typisch?“ ist noch lange nicht beantwortet. Und die kontroverse Diskussion geht wohl auch noch nach der Einigung der OIV auf einen Wortlaut der Definition von Terroir weiter.
|
 |
„Ein Weinbauterroir ist ein gebietsbezogenes Konzept, wobei für das jeweilige Gebiet kollektive Kenntnisse der Wechselwirkungen zwischen identifizierbaren physikalischen und biologischen Faktoren und den dort angewandten weinbaulichen Verfahren gewonnen werden, die den Produkten dieses Gebiets ihre Einzigartigkeit geben.
Das "Terroir“ umfasst spezifische Eigenschaften des Bodens, der Topografie, des Klimas, der Landschaft und der biologischen Vielfalt.“ (RESOLUTION OIV/VITI 333/2010, 25. Juni 2010)
|
 |
Ob Weine Terroirprägung zeigen oder nicht, artet nicht selten in philosophische Streitereien aus. Es stehen sich zwei Lager gegenüber: Auf der einen Seite die „Terroiristen“, die die Einzigartigkeit der Lagen in den Weinen wiedererkennen wollen und auf der anderen Seite die Skeptiker, die der Herkunft allenfalls einen marginalen Beitrag zum sensorischen Gesamtbild eines Weines zugestehen.
Unabhängig von den Fragen, was die Typizität von Weinen mehr oder was sie weniger prägt, bleibt aus Vermarktungssicht festzuhalten, dass es bestimmte Kundengruppen gibt, die authentische Produkte suchen. Es gibt eine Zielgruppe für Terroirweine, die bereit ist für Produkte mit Herkunft (mehr) Geld auszugeben.
Ferner ist es eine Marketing-Binsenweisheit, dass insbesondere die Produkte interessant sind, die einzigartig, nicht einfach kopierbar und unterscheidbar sind. Eine Region, ein geologisch homogenes Gebiet oder gar eine Einzellage haben deshalb grundsätzlich das Potenzial, Markencharakter (immer in Verbindung mit dem Weingut/Winzer) aufzubauen.
Last but not least, hat das klassische deutsche Differenzierungskriterium, das Mostgewicht, ausgedient. Deshalb lohnt der Blick auf das Terroir-Konzept, nicht nur aber auch als Mittel zur Sortimentsgliederung in direkt vermarktenden Weingütern. Dabei sind Terroirweine sicher nichts für Weineinsteiger und/oder das Basissegment, sondern es sind erklärungsbedürftige Produkte für Weinenthusiasten, die aber imageprägend für ein Weingut sein können.
Das Kompetenzzentrum Weinmarkt & Weinmarketing Rheinland-Pfalz hat eine Internet-Befragung von Winzern durchgeführt, um die Einstellung der Betriebe zum Thema Terroir zu untersuchen. Beteiligt haben sich 216 Betriebe mit Flaschenweinvermarktung aus ganz Rheinland-Pfalz.
Mit der Befragung sollten im Wesentlichen drei Fragen beantwortet werden:
- Wie sieht das Angebot von terroirgeprägten Weinen bei Weingütern derzeit aus?
- Was macht aus Sicht der Weingüter einen Terroirwein aus?
- Wie kommunizieren die Betriebe das Thema gegenüber dem Kunden?
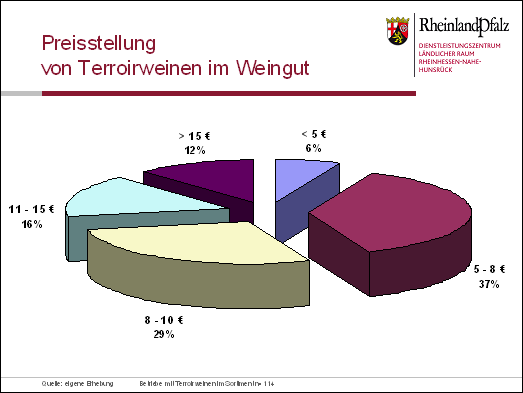 |
 |
Terroirweine bei vielen schon fester Bestandteil des Sortiments
Rund 53 % der Weingüter gaben an, bereits heute terroirgeprägte Weine im Sortiment zu führen, die auch als solche kommuniziert werden (im Folgenden „Terroir-Betriebe“ genannt). 10 % der Befragten planen eine Einführung, während 37 % nach eigenen Angaben keine vergleichbaren Produkte anbieten (im Folgenden „Nicht-Terroir-Betriebe“ genannt). Diese Gruppen unterscheiden sich deutlich in der Einstellung zu und den Umgang mit Terroirweinen. Darauf wird später noch einmal zurück zu kommen sein.
Terroirweine sind hinsichtlich ihrer Preisstellung ein hochattraktives Segment. Bei immerhin 27 % der befragten Weingüter liegen sie im Bereich über 10 €/Flasche. 28 % bieten zwischen 8 - 10 € an. 37 % platzieren die Produkte zwischen 5 - 8 €. Insgesamt besetzen Terroirweine eine Preisposition, die neben der notwendigen Attraktivität für den Kunden auch Wertschöpfung für den Winzer ermöglicht.
|
Neben dem Riesling gibt es eine Reihe von anderen Rebsorten, denen die befragten Winzer zutrauen, Terroircharakter zu zeigen. Häufig wurden mehrere Rebsorten oder Rebsortenfamilien genannt. Bislang haben sich die Arbeitskreise und Forschungsprojekte allein mit dem Riesling befasst. Es zeichnet sich bei den Winzern aber deutlich ab, dass der Kreis der Rebsorten - in Versuchswesen und Beratung - erweitert werden muss.
Die meisten Nennungen (70) entfielen auf den Silvaner. Vor allem die Rheinhessen sehen im Silvaner eine Rebsorte, die das Potenzial hat, Herkunft schmeckbar zu machen. In der Pfalz und an der Nahe gibt man dem Weißburgunder gute Chancen. Überhaupt wird die Burgunderfamilie insgesamt recht häufig genannt.
Im Rotweinbereich ist der Spätburgunder der klare Favorit der Winzer. Über ein Fünftel der Befragten glaubt, dass der rote Klassiker neben dem Riesling am Besten geeignet ist, Terroirweine hervorzubringen. Die Franzosen haben es vorgemacht und die rheinland-pfälzischen Anbaugebiete müssen sich über Stilistik und Herkunftsprägung Gedanken machen.
|

|
Was macht einen Terroirwein aus?
In der Internet-Befragung wurden die Winzer gebeten, den Grad der Zustimmung zu bestimmten Aussagen mitzuteilen. Die 5er-Skala reichte von „stimme voll zu“ bis „stimme nicht zu“.
Der Aussage „Terroir bedeutet vor allem das Herausarbeiten der Bodentypizität eines Weines“ konnten z.B. 59 % aller Befragten zustimmen, bzw. voll zustimmen. Nur 9 % stimmten dieser Aussage nicht zu. Ein Ergebnis, dass so sicher erwartet werden konnte. Was aber auch andeutet, dass den Winzern neben dem Boden noch andere Parameter wichtig sind. So spielt z.B. das Mikroklima nach der Einschätzung von 72 % der Befragten eine große Rolle bei der Ausprägung des Terroirs.
Genauso eindeutig, wie die Zustimmung zum Einfluss des Mikroklimas ist die Ablehnung von Stress im Weinberg. Mit der Aussage, dass Terroirweine ein gewisses Maß an Stress im Weinberg brauchen, konnten sich nur 13 % anschließen. Fast 20 % stimmten zumindest teilweise zu, während die große Mehrheit von 60 % wenig oder keine Zustimmung gab. Sicher ist das Ergebnis auch der Tatsache geschuldet, dass zur Zeit überwiegend Terroir-Weißweine produziert werden.
Bei der „defensiven“ Kellerwirtschaft stehen sich zwei Meinungen gegenüber. Für die Weingüter, die bereits Terroirweine im Sortiment haben, ist eine defensive Kellerwirtschaft unabdingbar. 58 % stimmen dieser Aussage zu. Teilweise können sich weitere 20% anschließen, während 18 % weniger bis gar nicht zustimmen können. Deutlich skeptischer ist die Sicht der Betriebe, die bislang noch keine Terroirweine im Sortiment haben. Nur 29 % wollen der Aussage („Wer Terroirweine will, muss eine defensive Kellerwirtschaft betreiben.“) zustimmen. Die Mehrheit (32 %) stimmt weniger oder gar nicht zu. Zudem zeigt der relative hohe Anteil in dieser Gruppe, die keine Meinung haben, dass die Unsicherheit oder Unkenntnis noch recht groß ist.
Bei der Beurteilung der Spontanvergärung verhält es sich sehr ähnlich. Terroir-Betriebe stimmen der Aussage, das „Spontis die Terroircharakteristik verwischen“ zu 51 % weniger oder gar nicht zu. In der anderen Gruppe sind das nur 35 %. Auch in dieser Frage gibt es bei den Nicht-Terroir-Betrieben mit 20 % einen hohen Anteil, die keine Meinung haben. Betrachtet man die Gruppe der Weingüter, die Terroirweine über 10 € Flaschenpreis anbieten, näher, wird deutlich, dass für diese Betriebe Spontanvergärung und Terroir zusammengehören oder sich zumindest nicht ausschließen.
|
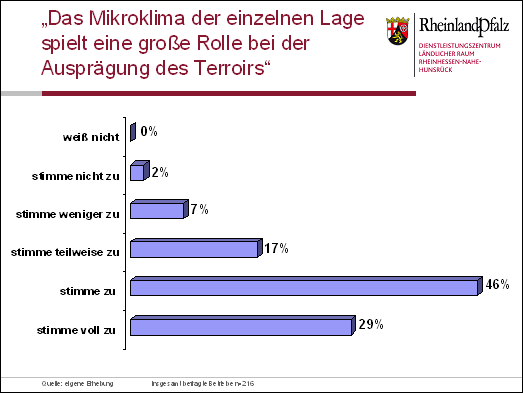
|
Wie sage ich’s dem Kunden?
Mit der Umfrage bei Weingütern wollten wir auch der Frage nachgehen, ob und wie das Thema Terroir bei den Weinkunden und Verbrauchern ankommt. „Wecken Terroirweine das Interesse der Kunden“, war eine Aussage, die die Betriebe bewerten sollten. Wie nicht anders zu erwarten, stimmen 70 % der Terroir-Betriebe zu oder voll zu. Gerade einmal 2 % stimmen weniger zu. Auch hier sind die anderen Betriebe skeptisch. Nur 20 % glauben, dass Terroir die Kunden interessiert. 36 % können zumindest teilweise zustimmen, aber 40 % stimmen weniger oder nicht zu. Gleichzeitig glauben Nicht-Terroir-Betriebe, dass das Thema Terroir auch beim Kunden noch gar nicht angekommen ist und eigentlich von der Presse mittlerweile überstrapaziert wird.
|
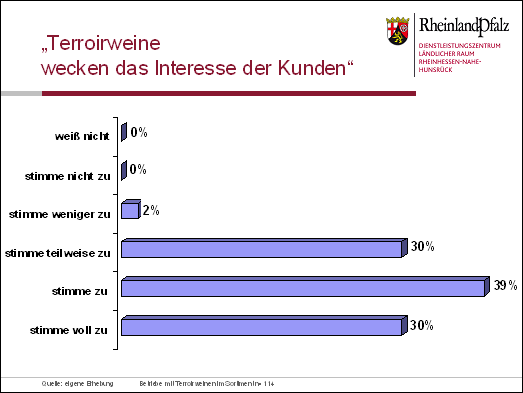
|
Demgegenüber versuchen Terroir-Betriebe vor allem im direkten Kontakt, wie z.B. bei einer Weinprobe das Terroir dem Kunden näher zubringen (95 %). Immerhin zwei Drittel arbeiten mit Texten zum Thema und Beschreibungen in der Preisliste. 42 % gaben an, dass sie Produktpässe oder Weinexpertisen nutzen. Auch die dekorative Komponente, mit Schaugläsern oder Bodenprofilen findet bei nahezu der Hälfte der Betriebe Anklang. Unterrepräsentiert, aber sicher ausbaufähig, ist die Kundenkommunikation über das Internet.
Trotz all dieser Maßnahmen sind die Betriebe, die bereits heute Terroirweine führen, überwiegend der Ansicht, dass das Thema beim Kunden noch nicht wirklich angekommen ist und demnach weiter spannend bleibt. Viele Weingüter fassen Terroir nicht nur als eine sensorische Komponente des Weinausbaus oder der Kellerwirtschaft auf, sondern setzen von der Gestaltung der Räumlichkeiten bis zur Architektur auf die Regionalität und Herkunft. Ganz im Sinne der OIV-Definition: „Terroir ist ein Konzept …“
|

|
Fazit der Befragung und Ausblick:
Terroirweine sind bei vielen Weingütern ein fester Bestandteil des Sortiments und preislich hoch attraktiv positioniert. Betriebe sehen neben dem Riesling vor allem den Silvaner und die Burgunderfamilie als terroir-fähig an, woraus sich für die Versuchs- und Beratungsinstitutionen sicher weitere Arbeitsfelder eröffnen. Die Gruppe der Terroir-Betriebe wird weiter wachsen.
Betriebe, die bereits heute Terroirweine im Sortiment führen, halten eine defensive Kellerwirtschaft für unabdingbar und experimentieren mit Spontanvergärung. In Sachen Stilistik und Typizität werden wohl noch einige Diskussionen geführt werden müssen.
Terroir ist und bleibt ein kommunikationsintensives Thema, mit einer enormen Chance sich betrieblich zu profilieren, Einzigartigkeit herauszustellen und unverwechselbar zu werden. Terroir-Konzepte umfassen Weinbau, Kellerwirtschaft und Vermarktung und können maßgeblich zum Markenaufbau von Weingütern beitragen. |
|