| |
| Versuchsfrage: | Einfluss des Bodenpflegesystems und einer gezielten Tropfbewässerung auf die Vitalität der Reben, die Ertragsleistung und Qualität der Rebsorte Riesling im Steilhang. |
 |  |
 |  |
 |
|
 |  |
 |
|
| Ergebnisse: | Wasserversorgung verbessern - Erosion mindern
Der Wasserhaushalt lässt sich sowohl durch ein an Trockenstandorte angepasstes Bodenpflegesystem (z.B. Bodenabdeckung mit Holzhäcksel, Rindenmulch, Stroh) als auch durch Bewässerungsmaßnahmen (vorzugsweise Tropfbewässerung) deutlich verbessern. Letzteres hat jedoch keine zusätzliche Erosionsminderung zur Folge. Eine (alternierende) Dauerbegrünung mindert zwar die Erosion, führt aber gleichzeitig zu einer verminderten Wasser- und Nährstoffversorgung. Die offene Bodenhaltung ist in der Lage die Verdunstung über den Boden herabzusetzen, erhöht aber die Erosionsgefahr und beeinträchtigt die Befahrbarkeit.
Bodenabdeckung – ein an Trockenstandorte angepasstes Bodenpflegesystem
Aufgrund der mengenmäßigen Begrenzung der maximalen Ausbringungsmengen ist die Pflege der Abdeckung so zu gestalten, dass diese möglichst langsam verrottet. Wird eine Holzhäckselabdeckung gewählt, so ist ein möglichst grobes schwer abbaubares Material vorzuziehen. Um die Verrottung des Abdeckungsmaterials nicht zu beschleunigen sollte dieses auf keinen Fall eingearbeitet werden. Durch die Abdeckung wachsende Unkräuter sind aus diesem Grunde gegebenenfalls mit Herbiziden zu bekämpfen. Eine Holzhäckselabdeckung muss etwa alle drei Jahre erneuert werden, eine Strohabdeckung i.d.R. alle zwei Jahre. Stroh eignet sich v.a. für nicht zur Chlorose neigende Flachlagen und ist in Steillagen aufgrund der Rutschgefahr ungünstig. Ein weiterer Nachteil der Strohabdeckung stellt die erhöhte Brandgefahr dar.
Aus den Versuchen ging hervor, dass in Hang- bzw. Steillagen, in denen dem Oberflächenabfluss mit einem damit verbundenen Bodenabtrag eine große Bedeutung zukommt, eine Abdeckung des Bodens in der Lage war, die Wasserversorgung der Reben deutlich zu verbessern. Wie die gesteigerte vegetative und generative Leistung sowie die frühmorgendlichen Blattwasserpotentialmessungen belegten, konnte die Wasserversorgung auf trockengefährdeten Steillagen durch eine Bodenabdeckung zumindest bis Mitte September meist stärker verbessert werden als durch eine ab Mitte Juli einsetzende Tropfbewässerung mit wöchentlichen Wassergaben um 10-12 l/Rebe. Erreicht wurde dies durch eine geringere Verdunstung über den Boden und durch eine bessere Infiltration, welche die Erosion vollständig verhinderte und bei Starkregenereignissen zur Aufnahme und Nutzung der gesamten Niederschlagsmenge führte. Die gesteigerte Wuchskraft schlug sich auch in einer Steigerung der Schnittholzgewichte nieder. Wie die Ergebnisse der bisherigen Versuchsjahre belegen, sinkt die Wasserversorgung in der Holzhäckselabdeckung lediglich in Jahren mit lang anhaltender Trockenheit im Spätsommer ab etwa Mitte September unter die der Tropfbewässerungsvarianten ab. Ein sehr spät einsetzendes Wasserdefizit hatte aber keinen wesentlichen Einfuß auf die Mostgewichte.
Die Bodenabdeckung sorgte bereits in der Phase des stärksten Trieb- und Beerenwachstums unabhängig von den aktuellen Bodenwasservorräten für eine Steigerung der Wasserversorgung und brachte nach 2-3 Jahren einen zusätzlichen Nährstoffschub. Die Rebe reagierte deshalb nicht nur mit einem stärkeren Wuchs, sondern i.d.R. auch mit einer deutlichen Ertragssteigerung. In den Jahren 2007 und 2010 führte die durch die Holzhäckselabdeckung leicht forcierte Chlorose während der Blüte und sicherlich auch die stärkere Wuchskraft zu einer erhöhten Verrieselungsrate und somit zu einer geringeren (2007) bzw. zu keiner (2010) Ertragssteigerung. Im Jahr 2010 hatten diese Bedingungen auch eine erhöhte Stiellähme und -fäule zur Folge.
Die normalerweise höheren Erträge in der Holzhäckselabdeckung hatten jedoch nicht zwangsläufig eine Verminderung der Mostgewichte zur Folge, sondern gingen i.d.R. sogar mit einer mehr oder weniger deutlichen Mostgewichtssteigerung einher. Bisher konnte nur im Jahr 2006 bei starke Ertragssteigerung ein leichter Mostgewichtsrückgang beobachtet werden.
In den ersten beiden Jahren nach der Ausbringung hatte die Holzhäckselabdeckung trotz der deutlich besseren Wasserversorgung keinen Einfluss auf die N-Einlagerung in die Trauben. Ab dem dritten Jahr nach der Ausbringung setzte dann offensichtlich eine verstärkte Mineralisation unter der Bodenabdeckung ein, was zu einer verbesserten N-Versorgung (NOPA-Werte) der Rebe und somit auch zu einer Begünstigung der Hefeernährung führte. Die Bodenabdeckung führte in allen Versuchsjahren zur einer mehr oder weniger deutlichen Steigerung der NOPA-Werte im Most, deren Niveau durch eine Bewässerung, auch in Kombination mit einer N-Fertigation, nicht erreicht werden konnte. In vielen Jahren (auch in Trockenjahren im deutlichen Mostegwichtssteigeungen infolge der Bewässerung) hatte eine Bewässerung keinerlei Effekt auf die NOPA-Werte im Most.
Ein eindeutiger Einfluss der Bodenabdeckung auf den Botrytisbefall konnte bisher nicht festgestellt werden. Eine Ausnahme stellte das Jahr 2007 dar, in welchem die durch die Chlorose verstärkte Verrieselung zu einer Auflockerung der Traubenstruktur und somit zu einem geringeren Botrytisbefall führte. Im Jahr 2010 begünstigte der erhöhte Stiellähmebefall und die dichtere Laubwand allerdings den Botrytisbefall.
Tropfbewässerung – wenn eine standortangepasste Bodenpflege nicht reicht
Wenn eine an den Standort angepasste Boden- und Bestandspflege nicht ausreicht, sollte über eine Zusatzbewässerung nachgedacht werden. Diese bedarf im Sinne der Qualitätssicherung einer exakten Steuerung der Bewässerungsterminierung und der Wassermengen. Aus fachlicher Sicht ist eine Bewässerung unter den hiesigen klimatischen Bedingungen i.d.R. nicht vor Juli und bei anhaltender Trockenheit bis in den September sinnvoll. Bei Trockenheit sind in diesem Zeitraum in Abhängigkeit der Wasserspeicherfähigkeit des Bodens wöchentliche Wassergaben um ca. 10-12 l/Rebe als Richtwert anzustreben. Eine genaue Steuerung der Bewässerung ist nur nach Kenntnis der aktuellen Wasserversorgung möglich. Diese kann z.B. durch Messung der frühmorgendlichen Blattwasserpotentiale ermittelt werden. Mit etwas Erfahrung können die Blattwasserpotentialbestimmungen auf zwei bis drei Messungen und auf wenige Vergleichsstandorte reduziert werden. Wird die Bewässerungswürdigkeit nicht durch exakte Methoden beurteilt, besteht vor allem bei frühen Wassergaben und/oder zu hohen Wassermengen die Gefahr der Mengensteigerung und einer einhergehenden Qualitätsminderung.
Die Blattwasserpotentiale der (alternierenden) Dauerbegrünung, mit einer eher spärlichen gräserorientierten Begrünungsdecke, lag in allen Versuchsjahren etwa ab Mitte Juli mit Ausnahme des regenreichen Augustes 2006 und 2010 immer deutlich unter dem Bewässerungsschwellenwert. Dies zeigt die Trockenstressgefährdung dieses Standortes, welche in Abhängigkeit von der Witterung ab Mitte Juli bis in den September fast immer eine wöchentliche Wassergabe ohne Unterbrechung rechtfertigte. Auf diesem Standort war selbst eine wöchentliche Wassergabe von 12 l/Rebe nicht in der Lage die Blattwasserpotentiale dauerhaft in den Bewässerungsschwellenwert oder darüber anzuheben. In niederschlagsarmen Vegetationsabschnitten lagen die Blattwasserpotentiale trotz Bewässerung in allen Untersuchungsjahren zwar i.d.R. merklich über denen der nicht bewässerten Varianten aber dennoch oft deutlich unter dem Bewässerungsschwellenwert.
Die sachgerechte Tropfbewässerung führte zu einer wesentlich geringeren Ertragssteigerung als die Holzhäckselabdeckung. Es ist bekannt, dass sich eine Begünstigung der Wasserversorgung in der Zeitspanne zwischen Blüte und Erbsendicke der Beeren am stärksten ertragssteigernd auswirkt. Erklärt wird dies durch eine begünstigte Zellteilung und nach neueren Untersuchungen durch eine Ausbildung elastischerer Zellwände, welche sich später in der Reifephase stärker ausdehnen. Eine Bodenabdeckung begünstigte aber unabhängig vom Bodenwasservorrat auch in dieser Zeitspanne den Wasserhaushalt der Rebe, während eine exakt gesteuerte Bewässerung hier nur nach Bedarf wenig Wasser verabreicht oder i.d.R. erst nach dieser Zeitspanne einsetzt. Die Tropfbewässerung bewirkte im Versuch deshalb weniger eine Ertragssteigerung als viel mehr eine Ertragssicherung, welche je nach Jahr teilweise Mostgewichtsteigerungen um bis etwa 10°Oe zuließ.
Die Tropfbewässerung konnte in keinem Untersuchungsjahr den Gehalt an hefeverwertbarem Stickstoff (Aminosäuren, NOPA-N) in den Trauben steigern. Die höchste Wassergabe (12 l/ Rebe u. Termin) tendierte teilweise sogar zur geringsten N-Einlagerung in die Trauben. Bemerkenswert ist, dass auch die Fertigation mit immerhin 60 kg NO3-N/ha, verabreicht in den ersten vier Bewässerungsterminen (meist im Juli bis spätestens Mitte August), - wenn überhaupt - meist nur zu einer tendenziellen (nicht praxisrelevanten) Erhöhung der Stickstoffversorgung der Trauben führte. Wie auch aus anderen Versuchen bekannt ist, führen späte Fertigationen kaum noch zu einer erhöhten N-Einlagerung in die Trauben. Frühere Fertigationen, etwa ab der Blüte sind dagegen eher in der Lage die N-Einlagerung in die Trauben zu erhöhen.
Ein eindeutiger Einfluss der Tropfbewässerung auf den Botrytisbefall konnte bisher nicht nachgewiesen werden. Einen außergewöhnlich großen Einfluss auf die Botrytisbefallsstärke hatte im Jahr 2006 die Fertigation. Diese hatte hier zu einer dreifach höheren der Botrytisbefallsstärke geführt. Die Ursache lässt sich schwer ergründen, da die Laubwanddichte, der Holzertrag und selbst der hefeverwertbare Stickstoff in den Trauben gegenüber der „normalen“ Bewässerung nicht angestiegen waren. Im Jahr 2007 zeigte die Fertigation trotz deutlich gesteigertem Wuchs (auch gegenüber der Bewässerung ohne N-Zugabe) eine nur tendenzielle Erhöhung des Botrytisbefalls.
In Steillagen löst die Tropfbewässerung nicht das Problem der Erosion. Wird sie mit einer ganzflächigen Begrünung kombiniert, ist davon auszugehen, dass die Bewässerungsintensität erhöht werden muss.
Auswirkungen der Wasserversorgung zu unterschiedlichen Entwicklungsstadien auf die Ertrags- und Qualitätsleistung der Rebe: Die zeitlich differenzierte Bewässerungssteuerung im Jahr 2009 konnte folgendes aufzeigen. Es wurde deutlich, dass eine moderate Tropfbewässerung bis kurz vor Reifebeginn zwar eine Ertragsstabilisierung, aber keine oder nur einegeringfügige Mostgewichtserhöhung bewirkt, während eine Tropfbewässerung ab kurz vor Reifebeginn den Ertrag kaum/weniger erhöht, das Mostgewicht aber wie bei der durchgängigen (bedarforientierten) Bewässerung und der Bodenabdeckung um bis zu 10°Oe und mehr angestiegen ist. Dies zeigt, dass einer optimalen Wasserversorgung in der Reifephase neben der Erhaltung der Rebenvitalität eine besondere Bedeutung bezüglich der Zuckereinlagerung zukommt und eine Optimierung der Wasserversorgung vor Reifebeginn unter den hiesigen Witterungsbedingungen i.d.R. keinen oder allenfalls einen geringeren Einfluss auf das Mostgewicht ausübt. Es ist bekannt, dass frühe Wassergaben den Ertrag stärker zu steigern vermögen als späte Wassergaben (v.a. wenn erstere nicht exakt dem Bedarf der Rebe angepasst werden).
Der positive Einfluss einer Tropfbewässerung in der Reifephase konnte auf diesem Standort bereits in den Vorjahren immer wieder festgestellt werden.
Die Bedeutung einer guten Wasserversorgung in der Reifephase lässt sich auch daran erkennen, dass die vier von bisher zehn Untersuchungsjahren (2003-20012), in welchen keine Mostgewichtssteigerung durch Tropfbewässerung oder Bodenabdeckung zu erziehen war, ausnahmslos durch überdurchschnittliche Niederschläge im August charakterisiert waren. Die sehr gute Wasserversorgung in der Reifephase konnte hier die Mostgewichte derart steigern, dass weitere Maßnahmen zur Optimierung der Wasserversorgung (auch vor Reifebeginn) keine zusätzlichen Effekte brachte.
Dieser Sachverhalt steht im Gegensatz zu den rechtlichen Rahmenbedingungen der Bewässerung:
„Nach EU-Recht dürfen Reben zur Herstellung von Qualitätswein nicht beregnet werden. Die Länder sind jedoch ermächtigt Ausnahmeregelungen zu erlassen. So können in Rheinland-Pfalz entsprechend der Landesverordnung zur Änderung weinrechtlicher Vorschriften vom 30. Oktober 2002 im Ertrag stehende Rebflächen zur Steigerung der Qualität bis zum Eintritt der Traubenreife beregnet werden, wenn die Umweltbedingungen dies rechtfertigen. Die Umweltbedingungen rechtfertigen die Beregnung, wenn der Entwicklungsstillstand durch Trockenheit droht.“
Beim zuständigen Ministerium wurde deshalb angeregt die rechtlichen Vorgaben entsprechend der Versuchsergebnisse anzupassen. Nur so wird das Ziel der Rechtsvorgabe – „Steigerung der Qualität“ bei möglichst geringer Ertragssteigerung – erreicht. Auch ist in der Beratung derzeit nicht zu begründen, warum ein in der Reifephase unter starkem Trockenstress leidender Weinberg nicht bewässert werden darf. Winzer, die hier fachlich richtig handeln, verhalten sich rechtswidrig. In der oben aufgeführten Rechtsverordnung müsste deshalb der Passus „bis zum Eintritt der Traubenreife“ gestrichen werden.
Einfluss der Bodenabdeckung und der Tropfbewässerung auf die Weinqualität
Aus den Versuchen ging hervor, dass sich die sensorische Ausprägung, das Alterungspotential und die schmeckbare Qualität der ausgebauten Weines durch die Holzhäckselabdeckung und die Tropfbewässerung gegenüber der nicht bewässerten alternierenden Dauerbegrünung in den meisten Fällen nicht signifikant unterschieden. Dabei ist anzumerken, dass die Moste bei größeren Mostgewichtsunterschieden durch Anreicherung auf den gleichen Alkoholgehalt eingestellt wurden, um so den Einfluss, welcher von einem unterschiedlichen Alkoholgehalt ausgeht, zu eliminieren.
Teilweise wurde sogar die nicht bewässerte alternierende Dauerbegrünung in der Tendenz besser bewertet als die bewässerten Varianten und die Bodenabdeckung. Letzteres ist sicherlich mit der (deutlich) höheren Ertragsleistung zu erklären.
Zusammenfassung
Die Bodenabdeckung begünstigte den Wasserhaushalt durch einen verminderten Oberflächenabfluss bzw. durch eine verbesserte Infiltration und durch Herabsetzung der Evaporation. Sie ist deshalb besonders für erosionsanfällige Hang- und Steillagen prädestiniert. Die Rebenvitalität konnte damit merklich gesteigert werden. Die Begünstigung der Wasserversorgung bereits unmittelbar nach der Blüte hatte teilweise eine erhebliche Ertragssteigerung zur Folge. Dennoch sanken die Mostgewichte nur selten ab, sondern stiegen i.d.R. mehr oder weniger deutlich an. Die rechtlich begrenzte Auflagestärke bedingt bei einer Holzhäckselabdeckung etwa alle drei Jahre eine Erneuerung der Auflage. In nicht zur Chlorose neigenden Flachlagen kann zur Abdeckung im zweijährigen Turnus auch Stroh verwendet werden, welches in Steillagen aufgrund der Rutschgefahr ungünstig ist.
Eine sachgerecht gesteuerte Tropfbewässerung (Terminierung, Wassermengen) führte zu einer Ertragssicherung und weniger zu einer Ertragssteigerung. Diese lies in Abhängigkeit vom Jahrgang teilweise deutliche Mostgewichtssteigerungen zu. Wird sie zum Zwecke des Erosionsschutzes und als „Univeral-System“ für wechselnde Witterungsbedingungen mit einer ganzflächigen Begrünung kombiniert, ist davon auszugehen, dass die Bewässerungsintensität in Trockenperioden erhöht werden muss. Hier stellt sich der Frage der ökologischen Rechtfertigung eines solchen Systems.
Da die sensorische Ausprägung und das Alterungspotential der Weine (wenn die Weine durch Anreicherung auf den gleichen Alkoholgehalt eingestellt wurden) weder durch die Bodenabdeckung noch durch die Tropfbewässerung signifikant verbessert wurden, dienten die untersuchten Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserhaushaltes in erster Linie zur Steigerung der Rebenvitalität und zur Ertragssicherung auf trockenstressgefährdeten Standorten.

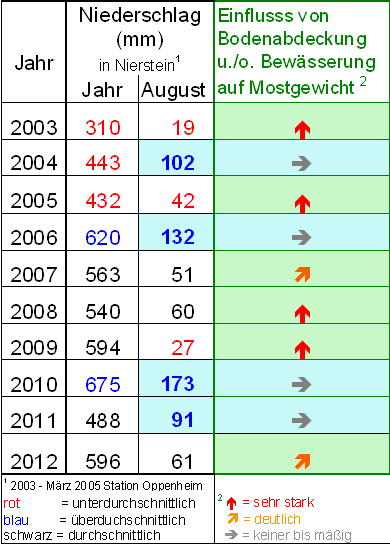 |
 |
|
 |  |
 |
|
 |
| Bemerkungen: | Veröffentlichungen des Versuchsanstellers (Dr. Bernd Prior) in welche Ergebnisse/Erkenntnisse aus diesem Versuch eingeflossen sind:
Tropfbewässerung zur Qualitäts- und Ertragssicherung in Rheinhessen - Wann sollte bewässert werden ? Das Deutsche Weinmagazin, Heft 8 (16. April), 2005, S. 32-37
Was bringt eine Tropfbewässerung ?
Der Deutsche Weinbau, Heft 5 (3. März), 2006, S. 14-17
Tropfbewässerung als Antwort auf Trockenstress ? - Versuchsergebnisse aus Rheinhessen
Das Deutsche Weinmagazin, Heft 5 (4. März), 2006, S. 22-27
Arbeitshinweise Juli 2006: Dem Wasserhaushalt anpassen
Das Deutsche Weinmagazin, Heft 15 (22. Juli), 2006, S. 8-9
Tropfbewässerung oder effizientere Nutzung von Niederschlägen?
Das Deutsche Weinmagazin, Heft 6 (17. März), 2007, S. 26-32
Bestandsführung an Klimawandel anpassen - Was tun 2007?
Das Deutsche Weinmagazin, Heft 10 (12. Mai), 2007, S. 22-27
Arbeitshinweise Juli 2007: Stand der Wasserversorgung
Das Deutsche Weinmagazin, Heft 14 (7. Juli), 2007, S. 8-9
Bodenabdeckung als Alternative zur Bewässerung
Die Winzer-Zeitschrift, März 2008, S. 29
Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserversorgung auf Trockenstandorten - Auch 2007 notwendig?
Das Deutsche Weinmagazin, Heft 7 (5. April), 2008, S. 10-15
Bodenabdeckung oder Tropfbewässerung
Der Deutsche Weinbau, Heft 8 (18. April), 2008, S. 16-18
Arbeitshinweise Juli 2008: Aktuelle Wasserversorgung
Das Deutsche Weinmagazin, Heft 14 (12. Juli), 2008, S. 8-10
Wasserversorgung von Weinbergsböden - Einflussfaktoren und standortangepasste Bodenpflege
Das Deutsche Weinmagazin, Heft 7 (4. April), 2009, S. 24-30
Abdeckung als Alternative zur Tropfbewässerung auf Trockenstandorten
Deutsches Weinbau-Jahrbuch 2009, S. 113-123
Tropfbewässerung und Holzhäckselabdeckung: Auswirkung der Wasserversorgung zu unterschiedlichen Entwicklungsstadien
Das Deutsche Weinmagazin, Heft 9 (30. April), 2010, S. 24-28
Tropfbewässerung: bewährte Lösungen
Der Deutsche Weinbau, Heft 9 (7. Mai), 2010, S. 16-17
Einfluss der Wasserversorgung auf Wuchs, Ertrag, Mostgewicht und Botrytisbefall - Versuchsjahre 2009 u. 2010
Das deutsche Weinmagazin, Heft 9 (7. Mai), 2011, S. 10-16
Ein Tropfen auf den heißen Stein - Im trockenen Weinjahr 2011 den Trockenstress notdürftig mindern
Landwirtschafdtliches Wochenblatt, Heft 23 , 2011, S. 38-40
Wann ist aus qualitativer sicht Bewässerung sinnvoll? - Wasserversorgung zu unterschiedlichen Entwicklungsstadien der Rebe
Pfälzer Bauer, Der Landbote, Heft 18 (4. Mai), 2012, S. 31-35
Grüngut und Holzhäcksel sind ideal zur Bodenabdeckung - Nutzen und neue rechtliche Regelung
Pfälzer Bauer, Der Landbote, Heft 18 (3. Mai), 2013, S. 33-35
Grüngut und Holzhäcksel als Bodenabdeckung im Weinbau - Nutzen und neue rechtliche Regelung
Das Deutsche Weinmagazin, Heft 10 (11. Mai), 2013, S. 34-37
Bewässerung: Einfluss auf Qualität und Menge
Der Deutsche Weinbau, Heft 19 (20. September), 2013, S. 12-15
Broschüre „Bewässerung“ aus der Reihe „Tipps für die Praxis“ (Meiningerverlag, 2005),
Weinbau-Jahrbuch 2009
Vorträge zum Thema:
Rheinhessische Agrartage in Nieder-Olm 2004, 2008 und 2012
Wintertagung in Bad Kreuznach 2006 und 2008
Weinbautage Mosel 10.1.2012
Sitzung "Arbeitskreis, Weinbau u. Umwelt" des Deutschen Weinbauverbandes 14.12.2012 in Framersheim
Pfälzischer Weinbautag am 16.1.2013 in Neustadt/Weinstraße
Arbeitstagung des Forschungsrings Deutscher Weinbau am 12.-13.3.2013 an der LWG in Veitshöchheim,
Fortbildung "Lehr- u. Beratungskräfte für Weinbau, Oenologie u. Marktwirtschaft RLP am DLR Rheinpfalz 26.6.2013
Veranstaltung des Weinbauverbandes an der Ahr im November 2013
61. Deutsche Weinbaukongress am 22.-24.4.2013 in Stuttgart
Weinbautag Saale-Unstrut, Freyburg am 25.1.2014
Kolloquium des Internationalen Arbeitskreises für Bodenbewirtschaftung und Qualitätsmanagement im Weinbau vom 7.-10.5.2014 in Oppenheim |
 |
|
 |  |
 |
|
 |
| Veröffentlicht in: |  |
 |
|
 |  |
 |
|
 |
| Download: |  Bodenpflege u. Bewässerung - Daten gesamt.ppt.pdf Bodenpflege u. Bewässerung - Daten gesamt.ppt.pdf |
|